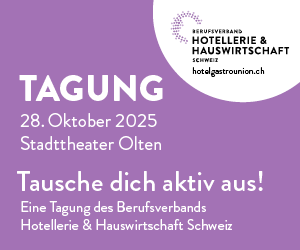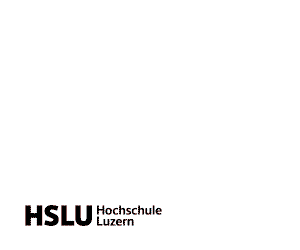«Was löst die Frage nach den vergessenen Anforderungen in der Pflege von Menschen mit Demenz am Lebensende bei Ihnen aus?» – mit diesen Worten wandte sich Prof. Dr. Heidi Zeller, Leiterin der Fachstelle Demenz an der FHS St.Gallen, bei ihrer Begrüssung an die über 1100 Teilnehmenden. «Wir möchten Sie zum Nachdenken anregen über die Bedürfnisse der Betroffenen in der letzten Lebenszeit. Denn Demenz wird bisher zu wenig als lebensbeendende Krankheit wahrgenommen».
Wie Studien zeigen, erhalten demenziell erkrankte Menschen in vieler Hinsicht eine schlechtere End-of-Life Care als beispielsweise Personen mit einer Krebserkrankung: «Die Betreuung durch ein spezialisiertes Palliative Care Team erfolgt seltener. Angehörige bekommen weniger Informationen zum Übergang in die End-of-Life-Phase. Schmerz und andere Beschwerden werden seltener erhoben und behandelt», berichteten Melanie Karrer und Angela Schnelli, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Fachstelle Demenz. Sie fragten Pflegende aus St.Gallen und der Region, welche Anforderungen in der End-of-Life Care von Personen mit Demenz zentral sind. «Es ist eine intuitive Arbeit, weil Menschen mit Demenz ihre Wünsche oft nicht mit Worten äussern können», lautete eine häufige Antwort.
Eine Kombination aus Erfahrung, Fachwissen und sensiblem Beobachten ist zentral. Für die Pflegenden ist es «etwas Schönes, Menschen mit Demenz in diesem letzten Lebensabschnitt zu begleiten». Die Befragten berichten aber auch von Zeitmangel und schwierigen Rahmenbedingungen in den Institutionen. Dadurch entsteht oft eine Kluft zwischen den Bedürfnissen der Personen mit Demenz und den Möglichkeiten einer hochwertigen Pflege.
«Dementia Care» mit «Palliative Care» verbinden
Wie ist es möglich, auch für Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz eine lebenszugewandte, sinngebende und durch Gemeinschaft geprägte Tagesstruktur zu gestalten? Wie lässt sich «leere Zeit» verhindern, wenn Betroffene nicht mehr an Gruppenaktivitäten teilnehmen können? Eine Antwort auf diese Herausforderungen bietet «Namaste Care» – ein multisensorisches Programm für Menschen mit fortgeschrittener Demenz.
«Das Wohlbefinden maximieren und die Lebensqualität erhalten – das sind die zentralen Ziele», berichtete Dr. Hubert R. Jocham, Dozent an der Fachhochschule Vorarlberg. «Namaste Care» spricht vor allem die Sinne und Emotionen der Betroffenen an – und somit diejenigen Wahrnehmungsformen, die bis zuletzt intakt bleiben. Im Zentrum steht sensorische Stimulation in Form von «Therapeutic Touch», Massage, Hand- und Fusswaschungen, Maniküre bzw. Pediküre sowie Aromatherapie. Naturvideos und Musik vermitteln angenehme visuelle und auditive Eindrücke. Das Programm kommt täglich zum Einsatz – jeweils zwei Stunden am Vor- und Nachmittag.
Ausgehend von den USA und dem St. Christopher`s Hospice in London übernahmen einzelne Institutionen in elf Ländern «Namaste Care». Eine eigens dafür eingerichteter «Namaste»-Raum gewährleistet eine ungestörte und geschützte Atmosphäre. Die pflegerischen Anwendungen sind jeweils individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse und die Lebensgeschichte der Bewohnenden. Dadurch kann persönliche Bedeutsamkeit entstehen. Auch Angehörige können sich beteiligen. Dies stärkt die Verbindung zwischen Menschen mit Demenz, Familienmitgliedern und dem Pflegeteam.
«Namaste Care ist nichts Neues», räumte Hubert Jocham ein. Innovativ ist jedoch die Verbindung von «Dementia Care», «Palliative Care», «End-of-Life-Care» mit einem personzentrierten Ansatz. Dadurch adressiert «Namaste Care» den vergleichsweise langwierigen Verlauf des «fortgeschrittenen Stadiums» einer Demenzerkrankung. Umso wichtiger ist es, diese letzte Lebenszeit im Sinne von Cicely Saunders so zu gestalten, dass die Betroffenen sich «so lange lebendig fühlen, bis sie sterben».
«Sterbegeschichten»
«Ich frage mich, ob der Tod vielleicht besser ist …», schreibt Wendy Mitchell in ihrem Internetblog «Which me am I today»? 2014 erhielt sie mit 58 Jahren eine Demenzdiagnose. Sie lebt in Yorkshire und ist Autorin des Buches «Der Mensch, der ich einst war». Wendy Mitchell denkt über «präventiven Suizid» nach. Sie weiss nicht, ob sie zusehen möchte, wie die Krankheit immer mehr von ihrem Gehirn Besitz ergreift: «Diese Person möchte ich nicht sein», betont sie. Die erschreckende Erfahrung des Selbst-Verlustes findet sich in vielen Erzählungen von Personen mit Demenz, wie Nina Streeck, Fachverantwortliche Ethik und Lebensfragen am Institut Neumünster, berichtete.
Sie stellte «Sterbegeschichten» von Menschen mit Demenz vor. So individuell diese Geschichten auch sind – die Rede vom «schleichenden Tod», vom «Sterben bei lebendigem Leib» und vom «Dasein als lebendige Tote» ist ihnen häufig gemeinsam. «Das Erwarten des drohenden Zusammenbruchs – das ist der eigentliche Alzheimer-Tod», so die Referentin.
Zu beobachten ist auch, dass in Geschichten über Menschen mit Demenz das Sterben oft nicht dargestellt ist. Dem Autor Arno Geiger war es beispielsweise ein Anliegen, über seinen Vater als «einen Lebenden» zu schreiben. Häufig enden die Geschichten, «bevor es schlimm wird». Denn das Sterben eines Menschen mit Demenz entspricht nicht dem Idealbild des «guten Sterbens». Nina Streeck zitierte auch Sätze aus dem Buch «Mutter, wann stirbst du endlich?» von Martina Rosenberg. Darin beschreibt die Tochter einen «schamvollen Tod» im Sinne des Soziologen Allan Kellehear. Aus Sicht der Tochter hat die demenzerkrankte Mutter bereits «alles verloren, was ihre Persönlichkeit ausmachte». Sie ist nur noch eine «leere Hülle». Die Tochter erlebt den Tod ihrer Mutter als befreiendes Ende «all der sinnlosen und grausamen Jahre».
Um Angehörigen und Mitmenschen «nicht zur Last zu fallen» und um sich «der Demenz zu entziehen», sehen manche Betroffene manchmal nur einen Ausweg: Sie wählen den Suizid – als letzten Akt der Selbstbestimmung, um die Integrität ihrer Persönlichkeit zu schützen, wie der Arzt Michael de Ridder in seinen Publikationen betont.
Symptome «lesen» und deuten
«Beobachten Sie und beschreiben Sie den Ärzten, was Sie sehen», so der Rat von Dr. med. Daniel Büche, Leitender Arzt am Palliativzentrum des Kantonsspitals St.Gallen, in seinem Referat. Anhand eines Beispiels zeigte er auf, wie zentral aufmerksames pflegerisches Beobachten ist, wenn Personen mit Demenz Symptome nur noch körpersprachlich zum Ausdruck bringen können.
Eine Patientin mit mittelschwerer Demenz hat eine Schambeinfraktur erlitten und erhält postoperativ Opioide. Den Pflegenden fällt auf, dass die Patientin auf Berührung am gesamten Körper mit Schmerzzeichen reagiert. Somit kann der Schmerz nicht ausschliesslich mit der Fraktur in Verbindung stehen. Alle Anzeichen deuten auf eine Hyperalgesie als Nebenwirkung der Opioid-Therapie hin. Dank genauer Beobachtung und Berichterstattung der Pflegenden gelingt es, die Schmerztherapie unverzüglich anzupassen. Fortschreitende Demenz verändert das Schmerzerleben, so der Referent. Das kognitive Bewerten des Schmerzes ist beeinträchtigt, ebenso die Aufmerksamkeit, die der Schmerz hervorruft. Verändert sich das kognitive Einordnen, fällt auch das Coping schwerer. Eine wichtige Leitfrage lautet deshalb: Was ist das stressauslösende Moment bei einem Schmerzgeschehen?
Symptommanagement basiert darauf, die «Interpretation des Patienten zu interpretieren», betonte Daniel Büche. Menschen mit fortgeschrittener Demenz sind maximal vulnerabel. Sie können Stressoren immer weniger tolerieren. Umso wichtiger ist es, ihre Körpersprache zu «lesen». Die wortlose «Symbolsprache» der Menschen mit Demenz zu verstehen, erwies sich als eine der wichtigsten Anforderungen hochwertiger Pflege am Lebensende. «Aufmerksames Wahrnehmen und Deuten» zog sich als «roter Faden» durch alle Referate, Workshops und Diskussionen.
Ein «Türöffner» für schwierige Gespräche
«Nicht leiden müssen», «Meine Würde bewahren» oder «Beim Sterben jemanden um mich haben» – diese Aussagen finden sich im Kartenspiel «RichtigWichtig», entwickelt von Elisabeth Sommerauer und Michael Rogner in den Pflegeheimen der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe. Das Kartenspiel kommt als «Türöffner» zum Einsatz, um vorausschauende Gespräche über das Lebensende einzuleiten. Nicht immer ist es leicht, eine «Brücke» zu finden, um dieses schwierige Thema anzusprechen.
«Der spielerische Charakter hilft uns dabei», so Elisabeth Sommerauer. Die Karten möchten dazu anregen, über Wünsche und Anliegen am Lebensende nachzudenken. Dadurch wird es möglich, Prioritäten zu setzen: 4 Was ist mir «sehr wichtig», «wichtig» oder «weniger wichtig»? Wäre es gut, das «sehr wichtige» Thema noch ausführlicher zu besprechen oder es zu dokumentieren? Die farbigen Punkte auf den Karten weisen auf die verschiedenen Ebenen von Palliative Care hin (rot = körperlich, gelb = sozial, blau = spirituell, grün = psychisch). So lässt sich feststellen, auf welcher Ebene die Anliegen hauptsächlich liegen und welche Gesprächspartner hilfreich sein könnten.
Als Inspirationsquelle diente das «Go Wish Game» aus den USA. Die deutschsprachige und bearbeitete Version hat sich inzwischen als wertvolle «Brücke» zu vorausschauenden Gesprächen bewährt. Das Spiel kann vielseitig zum Einsatz kommen – auch im Rahmen von Weiterbildungen oder im Kreis der Familie. Für das Projekt «RichtigWichtig» erhielt die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe den Anerkennungspreis der Viventis Stiftung.
Anders als in früheren Jahren vergab die Jury keinen Viventis Preis für das beste Praxisprojekt in der Pflege und Begleitung von Personen mit Demenz. Die eingereichten Projekte zeigten aus Sicht der Jury keinen ausreichenden Bezug zum Schwerpunkt «End-of-Life»-Care.
Die Grenzen des Verfügens
«Wer kann dem Menschen im Zerbrechen seines Lebens gerecht werden?», fragte Prof. Dr. Andreas Heller, Institut für Pastoraltheologie und -psychologie an der Universität Graz, im abschliessenden Referat über «Sterben zwischen Planungszwang und sozialer Mitsorge». Dabei wies er die Teilnehmenden auf ein Paradox hin. Im Sterben entgleitet dem Menschen die Verfügung über sein Leben. Dennoch fordert die Gesellschaft: «Du musst über dein Sterben verfügen! Wo und wie willst du sterben?».
Was für den sterbenden Menschen jedoch wirklich zählt, lässt sich nicht in Form eines «Sterbemanagements» organisieren, so der Referent. «Mitmenschliche Begegnungen sind nicht messbar. Sie entziehen sich der Logik des Machenkönnens. Die planende Vernunft stösst hier an Grenzen». Sich auf die sterbende Person einzulassen, Nähe zulassen und das Geschehen miteinander zu teilen, stiftet Gemeinschaft. Dadurch «durchbrechen» Menschen die «Privatisierung des Leidens und machen es öffentlich», betonte Andreas Heller. Menschen in ihrer Lebenssituation nicht alleine zu lassen, sondern Verbundenheit herzustellen – das bedeutet «Privates in Öffentliches zu übersetzen». Hierzu kann gerade die Pflege wesentlich beitragen – und dadurch eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung erhalten.
«Letzte Lieder»
«Am Schluss sind oft alle ernst. Diese Ernsthaftigkeit ist wie eine Decke, die schwer über allem liegt», berichtete Stefan Weiller über seine Besuche bei sterbenden Menschen in Hospizen. «Letzte Lieder», so seine Erfahrung, können diesen Ernst auf behutsame Weise überwinden. «Welche Musik ist Ihnen kostbar und welche Erinnerung verbinden Sie damit?» – ausgehend von dieser Frage konnte Stefan Weiller in seinem Projekt unzählige «Lebenslieder» von sterbenden Menschen sammeln. Hospizbewohnende sprechen mit ihm über die «Musik ihres Lebens» und hören sie mit ihm an. Lieder haben die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden und Gefühle miteinander zu teilen – ohne Worte.
Das Projekt «Letzte Lieder» bringt die Geschichten und Gedanken sterbender Menschen in die Öffentlichkeit. Das Zuhören bewegt dazu, sich eigene Fragen zu stellen. Lieder sind nicht nur lebenswichtig, sie sind auch im Sterben wichtig. – so die Botschaft von Stefan Weiller. Immer wieder erlebt er, dass sehr alte sterbende Menschen Trost in einem «Kinderlied» finden. Das Kinderlied «kann eine Brücke sein, die sich über die Zeit spannt». Deshalb die Bitte: «Singen sie mit ihren Kindern! Seien Sie sich bewusst, dass Sie dabei etwas Wertvolles in die Seele der Kinder hineinlegen. Etwas, das vielleicht später – am Ende des Lebens – wichtig werden kann …».
Autorin: Dr. Diana Staudacher, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FHS St.Gallen, Fachbereich Gesundheit.